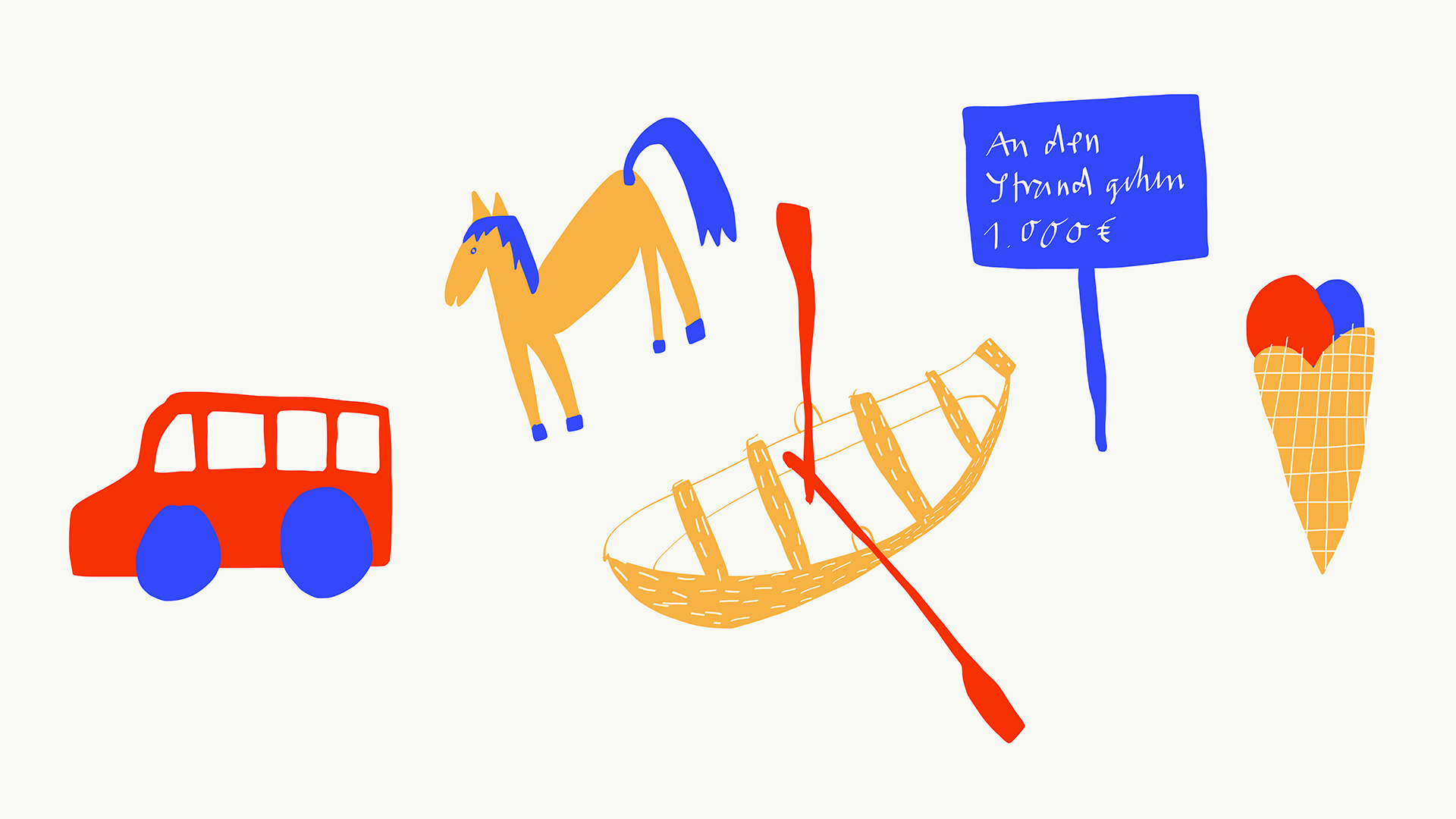
Alle schreiben jetzt Corona-Tagebücher.
Einige lese ich, ich höre leise lachend und ergriffen nickend Podcasts, sehe täglich kleine Zeichnungen und bin froh, nicht alleine zu sein mit dieser Seltsamkeit. Und gleichzeitig so überwältigt und ermattet von all dem Input und Output und Content und diesem stetigen Grundrauschen, den Nachrichten, die keine Nachrichten sind sondern Independence-Day-Gedächtnis-News, ich soll jetzt offiziell meine Symptome googeln, weil der Hausarzt keine Schutzkleidung hat und zwischen all den Meinungen und Aufgeregtheiten einen Trampelpfad der panikfreien Vorsicht einschlagen.
Das unfreiwillig Komische ist auch, dass ich in vielen Jahren Therapie gelernt habe »wird schon alles nicht so schlimm« zu denken und meinem irrlichternden Katastrophenverstand Leitplanken der Zuversicht zur Seite zu stellen und dann sowas. „Es ist nur in meinem Kopf“ stimmt ja nun nicht gerade, also gibt es neue Coping Strategien oder auch schlaflose Nächte und alle Gefühle gleichzeitig, denn irgendwo schlummert immer noch ein Stück vom Trauma und will raus.
Die Traurigkeit darüber, alle Hippie-Pläne auf Eis legen zu müssen, obwohl 2020 doch das Jahr sein sollte, in dem ich Boote vertäuen und Pferde streicheln und Roadtrips unternehmen wollte mit der ganzen Familie.
Ich wollte staubige Kinder und das Schwappen eines stillen Sees unter einem Stahlkanu. Jetzt sage ich entweder sehr kluge Sachen wie dieses Gebet der Anonymen Alkoholiker »wir müssen das gestalten, was in unserer Macht liegt, auf das Drumherum haben wir keinen Einfluss«, dann benutze ich wie in so einer schlechten Arztserie inflationär medizinische Fachbegriffe und checke Johns Hopkins vor dem Wetterbericht, ich erinnere pädagogisch mahnend »Gefühle sind wichtig, das Kind ist jetzt traurig, es darf rumschreien« und wenn die Sonne scheint und die Bäume sprießen, erwische ich mich bei meinen eigenen Bundespräsidenten-Ansprachen und verkünde »aber auch, wenn wir Abstand halten müssen, ist es gesellschaftlich wesentlich, füreinander da zu sein und nicht in Misstrauen zu verfallen.«
Vor weniger als einem Monat saß ich noch auf einer Insel mitten im Atlantik und durfte den Strand nicht betreten, ein Lautsprecher-Geländewagen der Polizei vermeldete neue Verbote, die Kinder spielten weiter mit anderen Kindern und warnten sich gegenseitig: An den Strand gehen kostet 1.000 Euro!
Vor weniger als einem Monat empfahlen wohlmeinenden Menschen, doch einfach im guten Klima zu bleiben und weiterhin salzige Luft einzuatmen, damit der lungengeschwächte Mann nicht zurückmüsse nach Gotham City Berlin und dort sterben, lieber also für immer auf einer Terrasse sitzen und das leere Meer angucken.
Vor weniger als einem Monat hatte ich, gewohnt an Ängste aller Art, meine erste japsende Panikattacke, nachdem der Mann, nach Rückkehroptionen im Falle der Frischluftverlängerung gefragt, „dann bleiben wir halt hier“ und „es gibt immer irgendwelche Segler, auch wenn die Häfen zu sind“ geantwortet hatte, „aber das Militär ist dem Innenministerium unterstellt und ich will nicht mit meiner Familie in einem Boot übers Meer flüchten mit irgendwelchen Seglern, wie Greta Thunberg“, waren meine letzten Worte und alles verschwamm, die Angst vor politischen Ausnahmezuständen, die Angst, eine falsche Entscheidung von großer Tragweite zu treffen, das Gefühl der Festung Europa und die Scham einer merkwürdigen Krisen-Aneignung, schließlich hatte ich doch einen deutschen Pass.
Vor weniger als einem Monat fiel der Rückflug aus und ich buchte auf einen Notflug um, und das macht etwas mit mir, es macht etwas mit mir, wenn Not das neue Normal ist, wenn Krise die Jahreszeit nach Winter ist, wenn ich Bilder von Leichen-Kühl-LKWs sehe und draußen die Vögel zwitschern, ich denke an Fukushima und bin zwischendurch sehr dankbar für die Entschleunigung und Ruhe da draußen, während drinnen der Hüttenkoller tobt und überall irgendetwas auf dem Boden liegt, aber ich bin krank und es kommt keiner zu Besuch.
Es macht etwas mit mir, seit Wochen krank zu sein während eine globale Seuche grassiert.
Es macht etwas mit mir, die schlafenden Kinder anzusehen und mich ganz plötzlich ganz schrecklich sterblich zu fühlen, wir brauchen doch noch Zeit füreinander, ganz viel Zeit, und dann kann ich wieder nicht atmen, weil ich zu viele Bilder von isolierten Menschen auf unzureichend ausgerüsteten Intensivstationen gesehen habe.
»Der Spielplatz ist ja leider zu« stellt das kleinen Kind nach dem Abendessen fest, zum Ausgleich zeige ich ihnen ein Parkour-Video auf Youtube, »die laufen sogar Wände hoch«, ziemlich einfältig von mir natürlich, und dann springen die Kinder im Wohnzimmer von Sessellehnen auf Tische und wieder zurück, ziehen sich nackt aus, »wir schwitzen«, sagen sie, und das ist es wohl, was alle meinen mit im-Moment-leben.
Ich telefoniere viel, obwohl das nicht mein gewähltes Medium ist und mit manchen Freunden telefoniere ich gar nicht, weil wir festgestellt haben, dass uns das nicht gut tut, wenn sich Angst potenziert.
